Artikeldetails
Oxana Matasova: Lautmalerei als Phänomen der Ikonizität (MU)
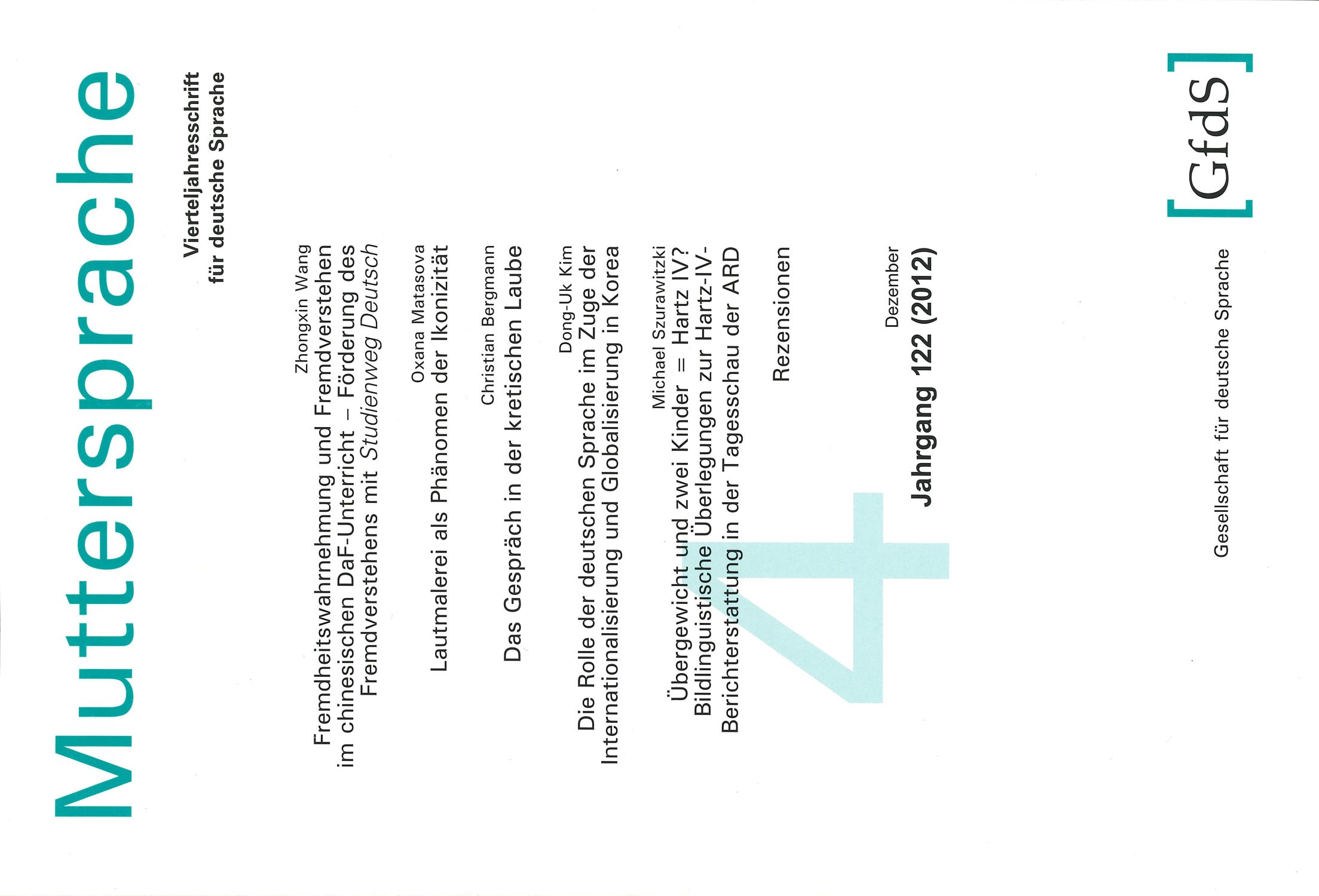
Produkttyp: Beitrag (Zeitschrift)
Autor(in): Oxana Matasova
Titel: Lautmalerei als Phänomen der Ikonizität
Publikation in: Muttersprache, 122. Jahrgang, Heft 4
Seiten: 268–281 (14 Seiten)
Erschienen: 15.12.2012
Abstract: siehe unten

Preis: 4,90 € inkl. MwSt.
(Download)
Abstract
Die Heterogenität der lautmalerischen Erscheinungen in der Sprache führte zu erheblichen definitorischen Problemen in diesem Bereich. Im angebotenen Artikel wird eine begriffliche Hierarchie im Bereich der Lautmalerei aufgebaut und eine terminologische Abgrenzung gegen Nachbarbegriffe vorgenommen. Als Kriterium für die Differenzierung der Schallnachahmung und der Lautsymbolik wird der ursprüngliche Bezug des Zeichenkörpers auf akustische Merkmale des bezeichneten Gegenstands verstanden. Aufgrund dieses Kriteriums wird zu den peripheren Gruppen wie Tierphonationen, Lock- und Scheuchlauten zu Tieren, Singimitationen sowie zu den Grenzphänomenen wie verbalen Bewegungsbezeichnungen, die zugleich hörbare und nicht hörbare Aspekten eines Phänomens wiedergeben, oder Lexemen, die sich auf mimische Denotate im weiteren Sinne beziehen, u. Ä. Stellung genommen. Anschließend wird mit Hilfe von etymologischer Analyse am Beispiel der deutschen Wurzel klack, die auf den gemeingermanischen schallnachahmenden Stamm zurückgeht und genetisch verwandte, phonologisch ähnliche Bildungen in vielen indogermanischen Sprachen hat, gezeigt, dass das lautmalerische Verhältnis zwischen Form und Bedeutung bei einem viel größeren Wortgut festzustellen ist, als es vorher zu ahnen war. Lautmalende Stämme weisen bedeutende wortbildende und semantische Produktivität auf. Parallele Bildungen mit analogischer Semantik in indogermanischen Sprachen demonstrieren die Entwicklung von komplexen semantischen Strukturen mit völlig demotivierten Bedeutungen aufgrund eines primären akustischen Sinneseindrucks.
The heterogeneity of onomatopoeic phenomena in language leads to considerable problems with their definitions. The presented paper contains an attempt to build a terminological hierarchy and make a terminological distinction in onomatopoeia. The criterion for the differentiation of onomatopoeia and sound symbolism is involuntary phonetically motivated connection between word forms and acoustic characteristics of the referent. This criterion is used to define the place of border phenomena (such as animal phonation, injections to lure or frighten off animals, imitative singing, verbs denoting movement which include acoustic and non-acoustic aspects, lexemes related to facial expressions in general etc.) in the onomatopoeic system of the language. The paper presents an example of a German root klack that can be traced back to a common Germanic onomatopoeic root and has etymologically and phonologically similar forms in all Indo-European languages. With the help of etymological analysis the paper proves that a much larger part of vocabulary is onomatopoeic in origin than could have been anticipated. Onomatopoeic word stems have significant word-forming and semantic productivity. Parallel sound combinations with similar semantics in Indo-European languages show the development of complex semantic structures with completely demotivated meanings based on primary auditory sensation.