Artikeldetails
Kiyosawa & Luschützky: Germanismen im japanischen Medizinerjargon (MU)
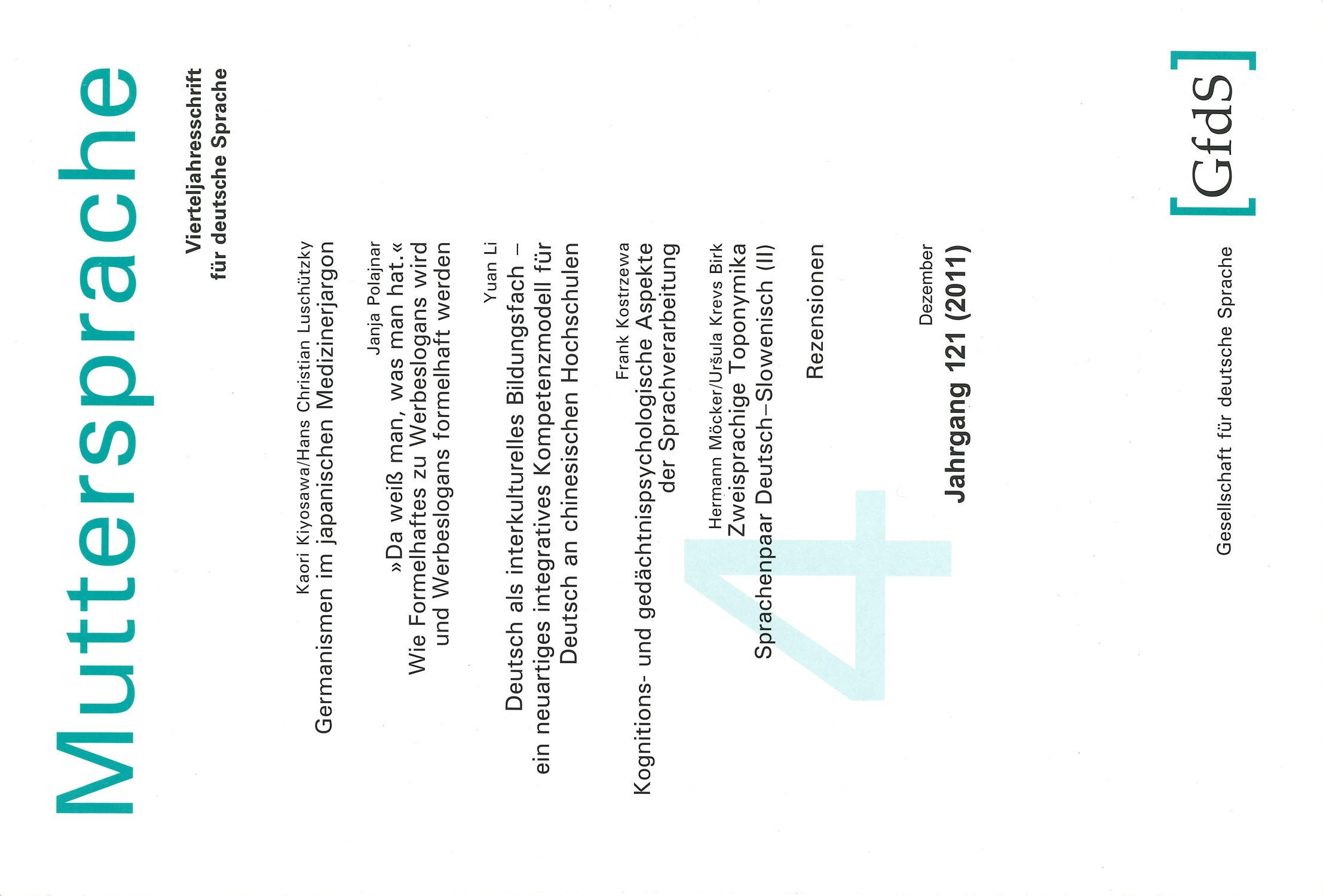
Produkttyp: Beitrag (Zeitschrift)
Autor(in): Kaori Kiyosawa / Hans Christian Luschützky
Titel: Germanismen im japanischen Medizinerjargon
Publikation in: Muttersprache, 121. Jahrgang, Heft 4
Seiten: 233–247 (15 Seiten)
Erschienen: 15.12.2011
Abstract: siehe unten

Preis: 4,90 € inkl. MwSt.
(Download)
Abstract
In der Sprachkontaktforschung gilt das Japanische, bedingt durch seine restriktive Phonotaktik,
seit jeher als Musterfall für Extremformen phonologischer Integration. Bei Gebersprachen wie
dem Chinesischen oder Portugiesischen kommt dies aus typologischen Gründen weniger zum
Tragen als bei Gebersprachen mit komplexer Phonotaktik wie Englisch, Niederländisch oder
Deutsch. Trotz dieser phonologischen Barriere ist das Japanische als durchaus entlehnfreudige
Sprache anzusehen. In einer rezenten Studie über den Lehnwortschatz in 41 Sprachen rangiert das
Japanische mit 36 % Lehnwortanteil im erweiterten Grundwortschatz auf Platz 7 der Rangliste,
vor Sprachen wie Indonesisch oder Swahili und nicht weit hinter dem Englischen mit seinen 42 %
(Haspelmath/Tadmor 2009).
Ein Großteil der weit über vierhundert Germanismen im Japanischen gehört bestimmten
semantischen Bereichen an: Naturwissenschaften, klassische Musik, Alpinismus und Skisport.
Wenig beachtet wurden bisher die Germanismen in der medizinischen Fachsprache, die
hauptsächlich in der Meiji-Zeit Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts ins Japanische
gelangten. Außerhalb Japans ist es kaum bekannt, dass sich aus diesem Fachvokabular in der
internen Kommunikation des im Gesundheitswesen tätigen Personals Jargonausdrücke gebildet
haben. Etliche dieser lexikographisch noch unzureichend erfassten Ausdrücke wurden innerhalb des
Medizinerjargons einer morpho(no)logischen und metasemischen Weiterbehandlung unterzogen,
die in diesem Beitrag anhand ausgewählter Beispiele dargestellt werden soll. Verschiedene Formen
der Wortkürzung und Ellipse, hybride (Um-)Bildungen, Hypostasen, Bedeutungsverengungen
und -erweiterungen sowie andere Prozesse, die dazu beitragen, den Medizinerjargon für
Außenstehende unverständlich zu halten, ergeben ein komplexes Bild. Die pragmatische Funktion
des Jargons, gruppeninterne Solidarität bei gleichzeitiger Abgrenzung nach außen zu stiften, wird
in einem Land, wo Deutschkenntnisse nicht sehr verbreitet sind, durch diese Germanismen in
hervorragender Weise erfüllt.
The Japanese language is well-known as a showcase example for phonological integration of
foreign words, due to its restrictive phonotactics. For donor languages like Chinese or Portuguese
this is less striking than in the case of donor languages with complex phonotactics such as
English, Dutch or German. In spite of this phonological barrier, Japanese is quite prone to lexical
borrowing. In a recent study on borrowings in 41 languages, Japanese occupies the seventh rank,
with 36 percent of borrowed words in the extended basic vocabulary, thus topping languages like
Indonesian or Swahili and ranging not far behind English, which has 42 percent of borrowed words
in the same lexical sample (Haspelmath/Tadmor 2009).
The majority of the over 400 German borrowings in Japanese belong to particular semantic
domains: science, classical music, mountaineering and skiing. A special set of German borrowings
that has been mostly neglected thus far persists in medical terminology, dating back to the Meiji
period at the turn from the 19th to the 20th centuries. Outside Japan it is almost unknown that a
repertoire of jargonized expressions has evolved out of these borrowings, which is used in internal
communication by medical staff. Some of these expressions, which are poorly documented in
lexicography, underwent morpho(no)logical and metasemic changes in the course of jargonization.
The examples presented in this article include various forms of shortening and ellipsis, hybrid (re-)
formation, hypostasis, semantic narrowing, extension of meaning and other processes, all ending
up in rendering the staff-internal medical jargon unintelligible for outsiders. The pragmatic function
of a jargon, i. e. the consolidation of group-internal solidarity with simultaneous exclusion of the
rest of the speech community, is served most effectively by these German borrowings in a country
like Japan, where knowledge of German is not very widespread.